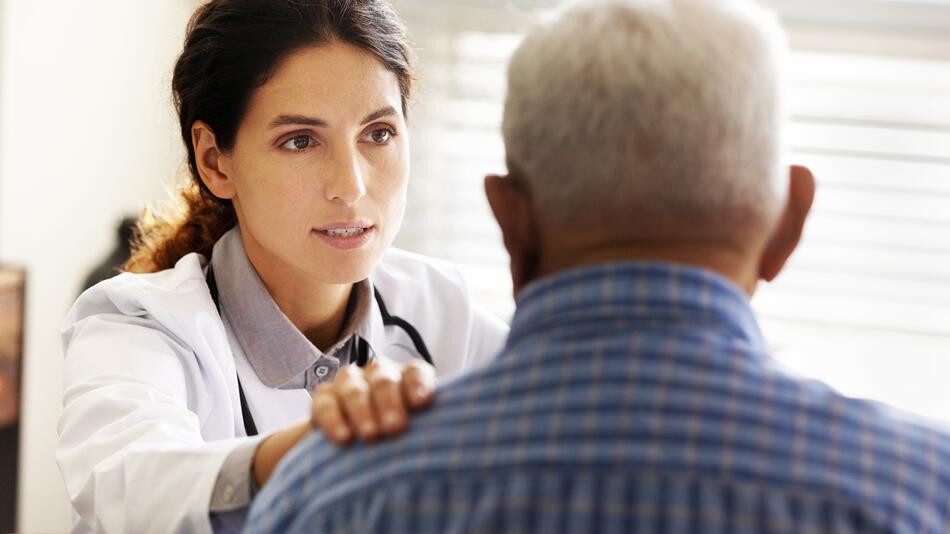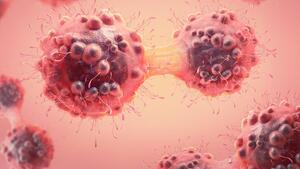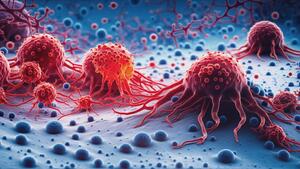An Blasenkrebs erkranken Männer fast viermal so oft wie Frauen, auch die meisten anderen Tumoren treten bei ihnen öfter auf. Die Krebsforscherin Andrea Kindler-Röhrborn erklärt, welchen Einfluss das biologische Geschlecht dabei hat, weshalb sich die Zahlen beim Lungenkrebs zwischen den Geschlechtern zuletzt angenähert haben und warum der Faktor Gewicht unterschätzt wird.
Frau Kindler-Röhrborn, wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit Geschlechterunterschieden bei Krebserkrankungen zu beschäftigen?
Andrea Kindler-Röhrborn: Ich habe zu bestimmten Grundlagen der Krebsentstehung geforscht und in diesem Zusammenhang Ratten mit krebsauslösenden Substanzen behandelt. Dabei habe ich gemerkt, dass die männlichen Ratten viel häufiger und viel schneller Tumore entwickelt haben als die weiblichen. Mein erster Impuls war ehrlich gesagt, das unter den Tisch zu kehren.
Warum das?
Ich dachte: Oh nein, nicht noch mehr Faktoren, die ich bei der Auswertung berücksichtigen muss, es ist doch alles schon kompliziert genug. Aber am Ende stellte es sich als wissenschaftliche Goldgrube heraus. Obwohl ich für mein erstes Paper 2006 noch viel Kritik abbekommen habe. Es hiess "Hat das überhaupt alles Hand und Fuss?" oder "Wir wollen das mal nicht übertreiben". Ich war völlig platt, als ich dann gesehen habe, dass es bei Menschen ähnlich ist wie bei den Tieren: Wenn man alle Tumorfälle auf der Welt abseits der Fortpflanzungsorgane betrachtet, entstehen bei Männern beinahe doppelt so viele Tumoren wie bei Frauen, nämlich 1,7-mal so viele.
Welche Krebsarten betrifft das?
Blasenkrebs trifft Männer bis zu viermal so oft wie Frauen. Aber auch bei Darm-, Lungen-, Nieren-, Magen- und Leberkrebs und bei Krebserkrankungen des Gehirns gibt es deutliche Unterschiede zu Ungunsten der Männer.
Warum ist das so?
Da spielen sowohl biologische Faktoren als auch Lebensstilfaktoren eine grosse Rolle. 30 bis 40 Prozent aller Tumor-Erkrankungen in Deutschland würden überhaupt nie auftreten, wenn unser Lebensstil nicht so extrem ausgeartet wäre.
Was meinen Sie damit?
Alkohol, Rauchen, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und starkes Übergewicht fördern die Entstehung von Tumoren. In geringerem Masse auch Umweltverschmutzung und beruflicher Kontakt mit Gefahrenstoffen wie zum Beispiel Asbest. Und Männer leben statistisch gesehen ungesünder als Frauen.
"Jüngere Frauen unter 45 Jahren erkranken fast genauso oft an Lungenkrebs wie jüngere Männer."
Beim Rauchen holen die Frauen allerdings auf.
Ja. Männer haben lange Zeit viel mehr geraucht als Frauen und unter älteren Menschen mit Lungenkrebs sind ungefähr doppelt so viele Männer wie Frauen. Im Laufe der Jahrzehnte ist aber die Zahl der rauchenden Frauen gestiegen und mit ihr auch die Lungenkrebsrate bei Frauen. Jüngere Frauen unter 45 Jahren erkranken fast genauso oft an Lungenkrebs wie jüngere Männer.
Ist das Rauchen nur für Lungenkrebs relevant oder auch für andere Krebsarten?
Auch für Brust- und Blasenkrebs zum Beispiel.
Sie haben vorhin auch Übergewicht erwähnt.
Bewegungsmangel und Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, spielen eine ganz wichtige Rolle. Das wird oft unterschätzt. Männer sind häufiger übergewichtig oder adipös als Frauen – und adipöse Menschen bekommen sehr viel häufiger Krebs als Menschen mit Normalgewicht. Dass schon vor der Covid-19-Pandemie die Lebenserwartung in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern kaum mehr gestiegen ist, wird unter anderem der immer weiter verbreiteten Adipositas und ihren Folgeerkrankungen zugeschrieben.
Worin besteht der Zusammenhang zwischen starkem Übergewicht und Krebs?
Das hat wahrscheinlich mit bestimmten Stoffen im Fettgewebe zu tun, die Krebs fördern können. Aber die genauen Kausalzusammenhänge sind noch nicht ganz klar.
Sie sagten vorhin, dass neben Fragen des Lebensstils auch biologische Faktoren zum höheren Krebsrisiko von Männern beitragen. Woher weiss man das?
2022 kam ein sehr interessanter Fachartikel heraus: Die US-Forschungsbehörde National Institutes of Health hatte in den 1990er-Jahren Hunderttausende Menschen in langen Fragebögen haarklein zu ihrem Leben und ihren Gewohnheiten befragt. Ein Team um Sarah S. Jackson vom National Cancer Institute hat die Daten noch mal ausgewertet und geschaut, welche dieser Menschen bis 2011 an Krebs erkrankt waren. Dabei kam heraus, dass die ganzen Lifestyle-Faktoren den Geschlechterunterschied nicht vollständig erklären konnten. Auch die Forschung an Tieren zeigt das: Die Laborratten bekommen alle das gleiche Futter, das gleiche Wasser und haben den gleichen Hell-Dunkel-Zyklus. Unterschiede bei ihnen müssen also genetische Gründe haben.
Was ist zu diesen Gründen schon bekannt?
Vor allem die Geschlechtschromosomen machen einen Riesenunterschied, dazu ist gerade in letzter Zeit einiges neu herausgekommen. Die meisten Frauen haben zwei X-Chromosomen, davon ist eines immer deaktiviert. Aber einige Gene auf dem inaktivierten X-Chromosom können der Inaktivierung entkommen. Dazu gehören auch Gene, die Tumore unterdrücken können. Von diesen Genen haben die meisten Frauen also zwei aktive Kopien – und wenn ein solches Tumorsuppressor-Gen defekt ist, können sie es mit dem zweiten kompensieren. Das können Menschen mit je einem X- und Y-Chromosom, also die meisten Männer, nicht. Das ist offenbar ein wichtiger Mechanismus bei diesem Thema.
Welche gibt es noch?
Einige Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Gene auf dem Y-Chromosom die Krebsentstehung ankurbeln können. Diese Studien sind aber ganz neu und wurden bisher nur an Tieren durchgeführt. Da lässt sich noch nicht viel über den Menschen sagen.
Viele Geschlechterunterschiede in der Medizin entstehen durch die Geschlechtshormone. Welchen Einfluss haben sie auf Krebs?
Geschlechtshormone können zur Tumorentstehung beitragen. In einem Versuch hat man zum Beispiel weiblichen Tieren die Eierstöcke entfernt, sodass sie keine Geschlechtshormone mehr gebildet haben. Wenn man sie mit krebsauslösenden Substanzen behandelt hat, haben diese Tiere keine Tumore entwickelt, die mit intakten Eierstöcken schon. Man weiss auch, dass Frauen, die nach der Menopause mit Hormontherapien behandelt wurden, häufiger Eierstockkrebs bekommen haben als Frauen, die keine entsprechende Behandlung bekamen. Die Geschlechtshormone scheinen aber vor allem bei geschlechtsabhängigen Tumoren wie eben bei Eierstockkrebs eine Rolle zu spielen, nicht so sehr bei Erkrankungen wie Leber- oder Darmkrebs.
"Die gleichen Gene, die dazu führen, dass Sie oder ich Krebs bekommen, haben unter Umständen bei Männern gar keine Auswirkungen – und umgekehrt."
Jetzt weiss die Forschung also: Fast alle Krebsarten kommen bei Männern häufiger vor. Was kann man mit diesem Wissen in der Praxis anfangen?
Man kann nach den Resistenzfaktoren suchen, die Frauen vielleicht haben, und so einen Schlüssel dazu finden, die Erkrankung zu stoppen oder von vornherein zu verhindern.
Salopp gesagt schaut man also: Wie machen die Frauen das? Und versucht, daraus eine Methode zu entwickeln?
Genau. Ein anderer Punkt ist, dass ja bestimmte vererbte Genvarianten Menschen anfälliger für Krebs machen. Jetzt hat man festgestellt: Die gleichen Gene, die dazu führen, dass Sie oder ich Krebs bekommen, haben unter Umständen bei Männern gar keine Auswirkungen – und umgekehrt. Ein bestimmtes Gen kann also bei einem Geschlecht ganz wichtig für die Tumoranfälligkeit sein und bei einem anderen gar nicht. Man denkt also auch darüber nach, wie man die entsprechenden Faktoren blocken könnte.
Gibt es Beispiele, wo das schon umgesetzt wird?
Noch nicht. Wir reden hier über Prävention, und die meisten Forschenden wissen: "There is no glory in prevention" (zu Deutsch: "Vorbeugung bringt keinen Ruhm"). Meist denkt man vor allem darüber nach, wie man eine Krankheit stoppt, wenn sie schon da ist. Deswegen ist dieser Forschungszweig noch ein bisschen unterentwickelt. Es gibt Ideen und im Tiermodell auch Erkenntnisse, bei denen man hellhörig wird, aber in die klinische Forschung hat das noch nicht Eingang gefunden.
Eine Krebsart sticht in den Statistiken hervor: Schilddrüsenkrebs trifft Frauen zwei- bis dreimal häufiger als Männer.
Ja, Schilddrüsenkrebs ist ein komplizierter Fall.
Inwiefern?
In der Schilddrüse entstehen häufig kleine Tumore, sogenannte Mikrokarzinome. Sie wachsen eine gewisse Zeit lang und wenn sie zirka einen Zentimeter gross sind, hören sie plötzlich auf zu wachsen. Niemand weiss genau, warum. In den allermeisten Fällen sind diese Karzinome harmlos und es gibt eine grosse Debatte darüber, ob man sie überhaupt rausnehmen muss. Die meisten Menschen, bei denen so ein Karzinom festgestellt und entfernt wird, sind Frauen. Aber meiner Meinung nach kommt dieses Ungleichgewicht daher, dass Frauen sich generell mehr um ihre Gesundheit sorgen, eher zum Arzt gehen, wenn sie einen kleinen Knoten am Hals ertasten und mehr Berührungspunkte mit der Schilddrüse haben: Sie leiden rund zehnmal so oft an der Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis wie Männer und die Funktion der Schilddrüse ist bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft wichtig. Männer hingegen interessieren sich meist überhaupt nicht für ihre Schilddrüse.
Das heisst, Schilddrüsenkrebs tritt bei Frauen gar nicht häufiger auf, sondern wird bei ihnen nur häufiger erkannt?
Darüber wird gerade heftig debattiert, andere Forschende und Ärzt*innen sehen das anders, aber in meinen Augen ist das so. In Studien hat man bei bis zu 30 Prozent aller Autopsien von Menschen, die an anderen Ursachen verstorben sind, Mikrokarzinome in der Schilddrüse gefunden – ohne Unterschied zwischen den Geschlechtern.
Sie haben am Anfang erzählt, dass Ihre ersten Fachartikel zu Geschlechterunterschieden bei Krebs heftig kritisiert und angezweifelt wurden. Ist das Thema unter Fachleuten mittlerweile akzeptiert oder weiterhin umstritten?
In der onkologischen Forschung hatte ich weniger Probleme, da zählt einfach, was man zeigt. Unter Mediziner*innen, vor allem unter den älteren, gibt es immer noch viel Skepsis. Bei den fortschrittlicheren ist es inzwischen anerkannt. Es kristallisiert sich zum Beispiel immer mehr heraus, dass auch bestimmte onkologische Therapien je nach Geschlecht unterschiedlich durchgeführt werden müssen. Früher hat man die ganzen Studien gar nicht nach Geschlecht getrennt ausgewertet – jetzt, wo man das häufiger macht, findet man viele Unterschiede.
Worin bestehen die?
Bei bestimmten Krebserkrankungen brauchen Sie als Frau ein anderes Regime (ein Therapieplan; Anm.d.Red.) als ein Mann. Also unterschiedliche Substanzen oder unterschiedliche Mengen davon. Allein durch die unterschiedlichen Anteile von Fett und Muskelmasse im Körper wirken manche Therapien je nach Geschlecht unterschiedlich und zwar unabhängig von Grösse und Gewicht einer Person.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Bestimmte Chemotherapeutika, die standardmässig unter anderem bei Magenkrebs und bei fortgeschrittenen Dickdarmkarzinomen eingesetzt werden, lösen bei Frauen häufiger Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall aus als bei Männern. Von den sogenannten EGFR-Inhibitoren (Arzneistoffe, die bestimmte, das Tumorwachstum fördernde Rezeptoren blockieren; Anm.d.Red.) profitieren Frauen mit einer bestimmten Art von Lungenkarzinom mehr als Männer mit dem gleichen Karzinom. Und bei der unter Erwachsenen in westlichen Industrieländern häufigsten Form von Leukämie, der chronischen lymphatischen Leukämie, zeigt eine ganze Reihe von Kombinationstherapien mit dem Antikörper Rituximab bei Frauen eine bessere Wirkung als bei Männern.
Über die Gesprächspartnerin
- Dr. Andrea Kindler-Röhrborn ist Krebsforscherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschlechtersensible Medizin des Universitätsklinikums Essen, das sie 2024 mitgegründet hat. Zuvor hat sie am dortigen Institut für Pathologie die Forschungsgruppe Molecular Cancer Prevention Research geleitet.
Über RiffReporter
- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.
- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.
Verwendete Quellen
- Datawrapper: An den meisten Krebsarten erkranken Männer häufiger
- PubMed National Library of Medicine: Sex disparities in the incidence of 21 cancer types: Quantification of the contribution of risk factors
© RiffReporter