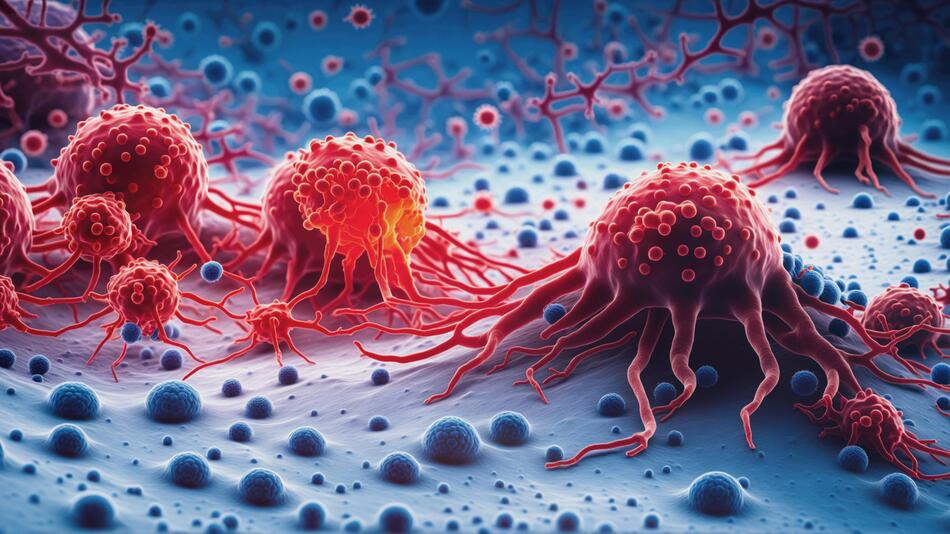Die Angst, an Krebs zu erkranken, ist bei vielen Menschen gross. Dass diese Angst aber auch dazu motivieren kann, sich besser vor einer möglichen Krebserkrankung zu schützen, erklärt die Forscherin Hanna Heikenwälder im Interview. Sie spricht ausserdem über die Rolle von Vorsorgeuntersuchungen, die Möglichkeiten von KI im Rahmen der Krebsforschung und sie erklärt, was hinter der sogenannten "Vision Zero" steckt.
Eine Krebsdiagnose bedeutet häufig viel Schmerz, Leid und häufig auch den Tod. Können Sie erklären, was genau Krebs eigentlich ist?
Hanna Heikenwälder: Krebs gehört zur Biologie des Lebens, was sich darin zeigt, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere oder Pflanzen an Krebs erkranken. Krebs wird in unserer Gesellschaft häufig mit dem Attribut bestückt, dass "mir das schon nicht passieren wird". Dieser Glaube ist fatal. Denn genau wie das Altern findet in jedem Körper eine Krebsentstehung statt und dieser Tatsache müssen wir uns bewusst werden. Krebs betrifft uns alle. Ab einem gewissen Alter tragen wir alle Krebsvorstufen in uns. Die meisten sind Gott sei dank gutartig, aber die Hoffnung, dass der Kelch gänzlich an einem vorübergeht, ist leider falsch. Krebs ist keine Frage des "ob", sondern des "wann" und "wo zuerst". Und ob man vorher möglicherweise an etwas anderem stirbt.
Welche Rolle spielen Früherkennungsprogramme in diesem Zusammenhang?
Trotz Früherkennungsuntersuchungen, wie etwa der Mammografie bei Brustkrebs, ertasten die meisten Brustkrebsbetroffenen den Tumor in ihrer Brust selbst. Insofern sollten wir trotz Früherkennungsprogrammen auf unseren Körper achten. Dazu gehört auch, mögliche Symptome ernst zu nehmen. Dabei darf man nicht vergessen, dass die meisten Früherkennungsuntersuchungen erst ab einem gewissen Alter möglich sind. Auch ein junger Mensch kann an Krebs erkranken. Häufig werden sie und ihre Symptome aber nicht ernst genommen, weil die Betroffenen nicht in die klassischen Risikoprofile passen. Umso mehr muss uns bewusst werden, dass bei jungen Patientinnen und Patienten die klassischen Risikofaktoren nicht immer gegeben sein müssen. Tatsächlich gilt: Je jünger der Patient, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass erbliche genetische Faktoren eine Rolle spielen. Hat eine Person also Blut im Stuhl oder einen Knoten in der Brust, müssen diese Symptome ernst genommen werden – egal, wie jung dieser Mensch ist. Letztlich kann nämlich eine Verzögerung in der Diagnose möglicherweise lebensgefährlich werden oder sogar tödlich enden.
Ihr Buch heisst "Krebs – Das Ende einer Angst". Wovor genau haben die meisten Menschen eigentlich Angst, wenn es um Krebs geht?
Umfragen zufolge nennen Menschen Krebs als meist gefürchtete Erkrankung. Meiner Meinung nach spielt dabei nicht nur die Angst vor einer schweren Krankheit oder vor dem Sterben eine Rolle. Vielmehr ist es die Angst vor der Therapie in Form von Chemotherapie und Bestrahlung. Bedeutet: Die Menschen fürchten sich davor, was eben diese Therapien mit dem Körper machen. Dazu kommt das Gefühl der Ohnmacht, wenn die Therapien möglicherweise nicht anschlagen.
"Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden, dass eines Tages niemand mehr an Krebs sterben muss."
Mir war es wichtig, im Buchtitel von Angst zu sprechen. Denn nur wer Angst hat, schützt sich und seinen Körper und nimmt beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen wahr. Mit Blick auf Krebs ist eine gewisse Angst also begründet, weil in jedem Körper eine Krebsentstehung stattfindet. Dass ich mich in dem Buch mit der "Vision Zero" von Krebs beschäftige, bedeutet nicht, dass wir Krebs vollständig besiegen können. Krebs wird immer existieren. Denn zufällige genetische Veränderungen, aus denen Krebs häufig hervorgeht, werden wir nicht verhindern können.
Was ist also das Ziel der "Vision Zero" von Krebs?
Das Ziel ist, dass niemand mehr an Krebs sterben muss. Das verlangt aber, dass wir Krebs ernst nehmen. Für die Medizin und Forschung bedeutet das, Tumore zu untersuchen oder Immuntherapien auf jeden Betroffenen und jeden Tumor masszuschneidern. In der Theorie weiss die Medizin, was zu tun ist, aber die Umsetzung findet noch nicht im nötigen Tempo statt – darunter leiden Millionen betroffene Menschen. Jede Krebserkrankung hat ihre eigenen Besonderheiten und Risikofaktoren. Slogans oder Überschriften wie "Krebs wird heilbar" bringen mich demnach zum Kopfschütteln. Denn Krebs ist zu komplex, um allgemeingültige Aussagen dieser Art zu verbreiten. Aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden, dass eines Tages niemand mehr an Krebs sterben muss, weil wir ihn frühzeitiger erkennen und effizienter, weil gezielter, behandeln werden können. Wie das funktionieren kann und muss, ist sich die Wissenschaft mittlerweile sogar einig.
Wann sollte Früherkennung demnach beginnen?
So früh wie möglich. Nur rund fünf bis zehn Prozent aller Krebserkrankungen sind auf genetische Mutationen zurückzuführen. Die restlichen 90 bis 95 Prozent entstehen über Jahrzehnte im Laufe des Lebens. Krebsprävention muss also so früh wie möglich beginnen. Insofern plädiere ich dafür, dass dieses Thema bereits in den Schulen Einzug hält. Schon im Kindesalter sollte gelernt werden, wie gesunde Ernährung funktioniert oder wie man auf seinen Körper achtgeben kann.
In England etwa gibt es eine Abgabe auf Zucker, so weit sind wir hier noch nicht. Eigentlich bin ich keine Befürworterin von Verboten, aber die Tatsache, dass Werbung für Süssigkeiten konkret auf Kinder zugeschnitten wird, ist ernüchternd. Es geht nicht per se darum, Ungesundes wie Süssigkeiten zu verbieten – wir sollten Zucker aber auch nicht verharmlosen. Es gibt schier unzählige Studien, die einen Zusammenhang zwischen Stoffwechselstörungen und Tumorerkrankungen aufzeigen. Solange uns Menschen das Prinzip der Krebsentstehung aber nicht bewusst ist, schützen wir uns nicht ausreichend. Demnach beginnt die "Vision Zero" meiner Meinung nach damit, das gesellschaftliche Bild von Krebs zu korrigieren, um im nächsten Schritt über die Umsetzung von Massnahmen zu sprechen.
Vorsorgeuntersuchungen scheinen für viele Menschen dennoch ein gewisser Angstgegner zu sein.
Ja, hier spielt mitunter der bereits angesprochene Gedanke eine Rolle, dass "mich das schon nicht treffen wird". Dabei findet die Krebsentstehung in jedem Körper statt – die Frage ist, wie schon erwähnt, nur, wann und ob sie ausbricht. Ein weiterer Grund, dass viele Menschen zwar von Vorsorgemöglichkeiten wissen, sie aber trotzdem nicht in Anspruch nehmen, ist, dass Früherkennungsprogramme häufig in Debatten stehen.
Lesen Sie auch
- Kaffee kann laut Studie Risiko für manche Krebsarten senken
- Bluttest für die Früherkennung von Prostata-Krebs in der Kritik - was ist dran?
Ich denke da etwa an die Mammografie, wo Überdiagnosen eine Rolle spielen. Studien der WHO haben ergeben, dass auf zwei fälschlicherweise gestellte Diagnosen im Zuge einer Mammografie ein Todesfall verhindert werden kann. Hier gilt es also, mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in den Austausch zu gehen und sich seriös beraten zu lassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass all diese Studien erstellt werden, um die Früherkennung zu verbessern. Die Forschung und Medizin kann also nur besser werden, wenn wir lernen, wie wir besser werden können.
Welche Rolle spielt die Künstliche Intelligenz in diesem Zusammenhang?
In Form der KI haben wir erstmals ein starkes Mittel an der Hand, das Bilderauswertung oder das Sammeln von Daten besser beherrscht, als Menschen es jemals konnten. In der Krebsforschung ist KI genau das, was uns bislang gefehlt hat.
Wie meinen Sie das?
Wir sind immer an der Komplexität von Krebs gescheitert. Jeder Krebs hat andere Mutationen und Besonderheiten. Vor allem bei der Bildgebung kann KI hier Grosses bewirken. Inzwischen gibt es Apps, die Hautkrebs teilweise besser erkennen als ein Screening in einer Hautarztpraxis. Fotos der Hautveränderungen werden zusammen mit den Patientendaten gesammelt – durch das Machine Learning erkennt die KI bösartige Fälle oder Auffälligkeiten, die mit blossem Auge möglicherweise gar nicht erkennbar sind. Auf diese Weise schafft die KI ein sehr kräftiges Diagnose-Tool.
Dabei soll die KI natürlich nicht den Arzt oder die Ärztin ersetzen. Nichtsdestotrotz ist sie besser darin, Muster zu erkennen. Würde man dieses Prinzip etwa auf Mammografiebilder anwenden, hätten wir binnen weniger Jahre in allen entwickelten Länder wahnsinnig präzise Tools für die Auswertung dieser Röntgenbilder. Aus diesem Grund empfiehlt die WHO, das Mammografiealter zu senken – jedoch nur in Ländern, in denen entsprechende Forschungsarbeiten geleitet werden können. Dabei ist der Fortschritt nicht nur hierzulande wichtig, sondern in allen Ländern. Danach kann das wertvolle Wissen mit allen Ländern geteilt werden. Insofern denke ich, dass Früherkennung im Zusammenspiel mit der Personalisierung der Medizin und der Entwicklung in der KI unglaublich viele Möglichkeiten bietet.
Sie beschreiben Krebsprävention in Ihrem Buch als "modernste Anti-Aging-Therapie unserer Zeit" – was genau meinen Sie damit?
Anti-Aging ist in den letzten Jahren zu einem wahren Trendthema geworden. Dabei ist unser Alterungsprozess ein Schutzmechanismus vor Krebs. Im Laufe unseres Lebens sammeln wir immer mehr genetische Veränderungen in unseren Zellen an. Im Alter nimmt die prozentuale Menge jener Zellen, die sich aufgrund verschiedenster Schäden nicht mehr teilen, zu. Dieser Vorgang schützt uns zwar vor Krebs, auf der anderen Seite verliert der Körper aber dadurch sein Regenerationspotenzial. Die Haut wird in der Folge schlaffer, wir bekommen Falten und graues Haar.
"Dass viele Menschen mit Anti-Aging-Therapien die biologische Uhr eines gealterten Menschen zurückdrehen wollen, halte ich für gefährlich."
Deswegen steigt im zunehmenden Alter das Krebsrisiko: Die Anzahl der defekten Zellen steigt an und der Körper kann sich gegen eine mögliche Mutation von Zellen nicht mehr wehren. Dass viele Menschen mit Anti-Aging-Therapien die biologische Uhr eines gealterten Menschen gewissermassen zurückdrehen wollen, halte ich demnach für gefährlich. Viel cleverer wäre es, in jüngeren Jahren durch eine gesunde Lebensweise und ein gestärktes Immunsystem die Ansammlung von Schäden und dadurch auch das Altern selbst zu verlangsamen.
Über die Gesprächspartnerin
- Dr. Hanna Heikenwälder hat Molekularbiologie in Lübeck und den USA studiert, bevor sie an der TU München zu den Zusammenhängen zwischen Entzündungen und Krebsentstehung im Darm promovierte. Derzeit forscht sie zu Krebs und Altern an der Universität Tübingen. Im Februar ist ihr Buch "Krebs - Das Ende einer Angst" erschienen.